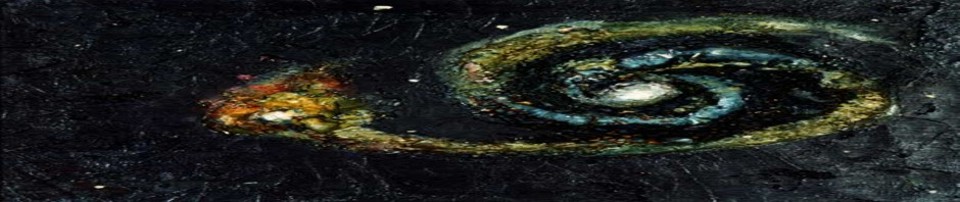Als ich vor der Schulentlassung mit 14 Jahren vor der Entscheidung stand, welchen Beruf ich erlernen sollte, hatte ich – anders als in der gegenwärtigen Wirtschafts- und Bildungssituation – eine echte Wahl. Die Zugangsvoraussetzungen zu Berufen waren für Abgänger der damals noch 8-jährigen Volksschule wesentlich weiter gefächert als für die heutigen Hauptschulabgänger. Deshalb hätte die Berufsberatung durch das Arbeitsamt durchaus Sinn gemacht – ein Betriebspraktikum gab es zu dieser Zeit noch nicht. Jedoch war mein erster Kontakt mit dieser Institution sehr enttäuschend. Als Berufswunsch teilte ich dem Berufsberater Radio- und Fernsehtechniker mit, allerdings hatte ich keine Vorstellung davon, welche Tätigkeiten in diesem Berufsfeld auszuüben wären. In dieser Hinsicht ging ich allerdings genauso ratlos von dem Beratungsgespräch fort, wie ich dort hingekommen war. Meine fragenden Blicke hatte der Berufsberater lediglich mit der Frage quittiert, ob ich denn schon einmal ein Radio repariert hätte.
Immerhin hatte diese Erfahrung bei mir bewirkt, dass ich gegenüber anderen Berufsbildern etwas aufgeschlossener war. Der nächste Anlauf fand in einer Druckerei statt. Meine Mutter war mit mir in das nahegelegene Münster gefahren, um mich in einem kleinen Druckereibetrieb vorzustellen, der mich zum Schriftsetzer ausbilden sollte. Hier beschränkte sich die Expertise des Lehrlingsausbilders nicht auf die analoge Gegenfrage, ob ich denn etwa schon einmal einen Buchtext gesetzt hätte, hier wurde die Probe aufs Exempel gemacht. Man gab mir einen kurzen Text, den ich mittels Setzkasten und Bleilettern in einem Winkelhaken nachbilden sollte. Die spiegelverkehrte Ansicht der Buchstaben war für mich zunächst befremdlich, doch das Ergebnis reichte aus, mich als möglichen Lehrling in Betracht zu ziehen.
Nun war ich soweit, meinen Weg in die scheinbar unausweichliche Arbeitswelt aktiv mitzugestalten. Die Bäuerin, bei der ich oder meine Mutter morgens die Milch holten schaltete sich mit gut gemeinten Ratschlägen ein. Meine Mutter hatte es nicht versäumt, sie über meine schulischen Leistungen zu informieren, wobei informieren eher eine nüchterne Untertreibung der Motive ist, die sie dazu antrieben. So kam es, dass unsere Milchbäuerin sich darauf festgelegt hatte, der Junge müsse Beamter werden. Dieser Rat aus dem Munde einer Bäuerin war eher ungewöhnlich, wie es auch ungewöhnlich war, wie ich später erfuhr, dass diese Bäuerin aktiv in der FDP tätig war.
Meine eigenen Überlegungen zu meiner beruflichen Zukunft kreisten schließlich um meinen Helden Old Shatterhand, der für den Schriftsteller Karl May den guten Weißen an der Indianerfront im wilden Westen darstellte und als Vermessungsingenieur beim Vorstoß in den unerschlossenen Westen für die Eisenbahngesellschaften Pionierarbeit leistete. Ohne das ich es voraus ahnte, verdichtete sich mein Berufsschicksal in einer Symbiose aus steter Gedankenmassage durch die Milchbäuerin und meinen Heldenphantasien zu einem ernst gemeinten Projekt der Lehrstellensuche im Berufsfeld Vermessungstechnik. Hierin verbanden sich die Aussichten, „Beamter“ – so wurde und wird auch heute noch vielfach jemand genannt, der im öffentlichen Dienst arbeitet – zu werden und meine Phantasien von einem naturwüchsigen Heldentum. Die Möglichkeiten, eine Lehrstelle für die Ausbildung zum Vermessungstechniker zu finden waren nicht sehr zahlreich, obwohl die nahe Stadt Münster hierfür
verhältnismäßig günstige Voraussetzungen bot waren es doch weniger als 10 Stellen, an die ich meine Lehrstellenanfrage schickte. Die interessanteste Antwort darauf war die der Stadt Münster, die beabsichtigte, im Vermessungs- und Katasteramt zwei Vermessungstechniker-Lehrlinge aufzunehmen. Mit der Antwort war die Einladung zu einem Eignungstest verbunden, der im Stadtweinhaus (für mich ein geheimnisvoller Name) stattfinden sollte. Dieser Test wurde meine Hoffnung und ich stellte alle weiteren Bemühungen um eine Lehrstelle ein.
Mit großer Spannung betrat ich am Testtag das Stadtweinhaus, welches direkt neben dem historischen Rathaus liegt, und war bereits von den Räumlichkeiten stark beeindruckt. Der Saal, in dem der Test durchgeführt wurde, war für eine größere Versammlung ausgelegt und ich erfuhr sehr bald, dass die Zahl der eingeladenen Bewerber 20 betrug und sich aus Bewerbern mit Abitur, Mittlerer Reife und Volksschulabschluss zusammensetzte. Diese Information dämpfte meine Erfolgserwartungen für einen kurzen Moment, doch ich war im Kampfmodus und ließ die Fragen erst einmal über mich kommen. Die Fragen des Tests waren ein Querschnitt durch das Allgemeinwissen mit dem Schwerpunkt auf mathematischen und kulturgeschichtlichen Aufgaben. Was mathematische Aufgaben betraf kam mir zur Hilfe, dass ich über Kenntnisse verfügte, die ich aus eigenem Antrieb erworben hatte und so wusste ich immerhin, was eine Quadratwurzel ist und konnte die diesbezügliche Aufgabe mit einem überschaubaren Zahlenbeispiel ohne spezielles Rechenverfahren im Kopf lösen. In manch anderer Hinsicht hatte mir auch die Abgeschiedenheit meiner Kindheit unter Bauern geholfen, die dazu geführt hatte, dass ich mit Vorliebe im einbändigen Herder Volkslexikon stöberte und überhaupt viel las. Ein weiterer Umstand war meine Schulzeit in der zweiklassigen Volksschule in dem Heideort Schmedehausen gewesen, wo ich die 5. und 6. Klasse mit den Schulkameraden der 7. und 8. Klasse in einem Raum gemeinsam absolvierte und so schon immer im Vorgriff auf das nächste Schuljahr Lernstoff aufnehmen konnte.
Am ersten April 1964 konnte ich meine Lehre beim Vermessungs- und Katasteramt antreten. Es begann damit eine Phase der Umerziehung vom einsiedlerischen Landbewohner zum Städter – gesteigert noch durch den gehobenen Anspruch der Bürokratie, in die ich eingebunden werden sollte. Keiner meiner Lehrlingskollegen hatte einen vergleichbaren persönlichen Werdegang und so führte ich auch in meiner neuen Umgebung ein Eigenleben, das mit gelegentlichem Spott und auch seltenen Gemeinheiten aufgeladen war. Es war mir klar, dass ich nur durch überzeugende Beweise meiner Zugehörigkeit zu der Gemeinschaft der Kollegen Anerkennung erhalten konnte. Hierzu boten sich die von den Lehrlingen auszuführenden persönlichen Dienstleistungen wie das morgendliche Austragen von Milch und Kakao im Drahtträger oder das fachgerechte Würstchenkochen an. Der Clou des Würstchenkochens bestand darin, das Wasser auf dem Gasherd zum Sieden zu bringen, die Würstchen erst dann in das kochende Wasser zu geben und bei erneutem Sprudeln des Wassers die heißen Würstchen zu entnehmen und zu servieren. Diese Tätigkeit gelang mir bald recht gut und mein Ansehen wuchs. Hierzu trug auch der von mir eingefädelte Handel mit frischen Eiern aus dem elterlichen Hühnerstall bei, der trotz einiger Schwierigkeiten im Winter, wenn ich bei Glatteis mit dem Fahrrad stürzte, zu einer verlässlichen Versorgungslinie wurde. Weitere Entlastung brachte die Ankunft neuer Lehrlinge nach meinem ersten Lehrjahr, so dass ich schliesslich ein akzeptables Lehrlingsdasein hatte.
Zu den erbaulichen Momenten meiner Lehrzeit gehörten die Frotzeleien unter den Kollegen, ihre Eskapaden in der Mittagszeit, in die wir Lehrlinge eingeweiht sein mussten, damit sie unentdeckt blieben, ihre besonderen Umgangsformen untereinander, wie etwa die Verballhornung der Namen, bei der aus „Große Bockhorn“ „Kleine Rehtrompete“ oder aus „Waterkamp“ „Paniacker“ wurde und der Namensträger Barfuß seinen Namen mit der Erklärung „ja, ganz richtig, Barfuß, wie Mann ohne Schuhe und Strümpfe“ am Telefon verständlich machte. Es wurden spannende Wettbewerbe ausgetragen, bei denen mechanische Rechenmaschinen gegen „Zufußrechner“ antraten und es wurden Anekdoten aus dem Leben als Geometer erzählt. Besonders aufregend waren für mich die Geschichten eines jungen Kollegen, der von seiner Zeit bei der Seismos erzählte. Diese Erzählungen kamen meinen Phantasien von einer Tätigkeit in unkultivierter Landschaft mit hohen Anforderungen an Improvisation und körperlichem Einsatz schon sehr nahe und so reifte in mir der Wunsch heran, mich nach Beendigung der Lehre auf den gleichen Weg zu begeben.
Meine Zukunftsplanung sah vor, dass ich zunächst die Fachholschulreife auf dem zweiten Bildungsweg nachholen wollte, um dann eine Ingenieurschule bzw. Fachhochschule zu besuchen. Auf diesem Weg ergab sich die Notwendigkeit, etwa ein halbes Jahr – einen Herbst und einen Winter – zu überbrücken. Hierzu bot sich der Außendienst bei einer Firma wie der Seismos an. Die ursprünglich zum Thyssen-Konzern gehörende Seismos GmbH war 1963 von der im Bundesbesitz befindlichen Prakla GmbH übernommen worden und war als einziges deutsches Unternehmen für Lagerstättenforschung weltweit tätig. Meine telefonische Anfrage bei der Firma in Hannover bezüglich einer Tätigkeit als Vermessungstechniker führte sehr bald zu einer Festanstellung. Mein erster Einsatzort war Rotenburg (Wümme). Ein älterer Kollege führte mich in meine Aufgaben ein und machte mich mit den Besonderheiten der Lagerstättenforschung bekannt, soweit dieses für mich von Bedeutung war. Was sich hier abzeichnete hatte mit dem, was ich bisher gelernt hatte nur im entfernten Sinne zu tun. In der Kataster- wie auch in der Ingenieurvermessung ist die Genauigkeitsanforderung des Ergebnisses im Zentimeter- bis Millimeterbereich angesiedelt, hier bewegte ich mich im Meterbereich. Doch der Reihe nach ein kurzer Überblick über dieses exotische Vermessungswesen.
Aufgabe des am Ort versammelten Messtrupps war die Erkundung des Untergrunds bis in mehrere tausend Meter Tiefe, um Beurteilungsgrundlagen für die Frage zu erhalten, ob im Untergrund Lagerstätten von wirtschaftlichem Interesse vorhanden sein könnten. Dabei zielte die Fragestellung in Norddeutschland insbesondere auf Erdöl und Erdgas ab. Die dazu benutzte Methode war die Refraktionsmethode, die konkret so ausgestaltet war, dass entlang einer schnurgeraden Messstrecke
von bis zu 10 km Länge im Abstand von 50 m Messstellen eingerichtet wurden, an denen mittels Geophonen Schwingungen aus der Tiefe des Untergrunds aufgezeichnet wurden, die durch Sprengungen in Tiefen bis zu ca. 30m erzeugt wurden. Zur Durchführung der hierfür erforderlichen Arbeiten war ein Messtrupp in verschiedene Einheiten gegliedert. Dem Arbeitsablauf folgend bestand ein Messtrupp aus dem Vermesser, der die Messstrecke, die Bohrstellen und die Messpunkte im Gelände zu markieren hatte sowie die Grundstückseigentümer der betroffenen Grundstücke zu ermitteln und zu benachrichtigen hatte, dem Bohrtrupp, der aus 7 Unimogs mit fest montierten Bohrgestängen nebst Besatzungen bestand, dem Sprengmeister, der die Löcher mit mehreren Kilo Spezialsprengstoff versah und für die Zündung zuständig war, den Kabellegern, die das Messkabel entlang der Messstrecke auslegten und die Geophone in die Erde steckten und der digitalen Aufzeichnungseinheit, die in einem Unimog untergebracht war und von zwei Spezialisten bedient wurde. Darüber hinaus waren für die Dauer der Messarbeiten, die sich über mehrere Wochen erstreckten, am Ort feste Büroräume angemietet, in denen der Truppleiter und eine Bürokraft arbeiteten. Dieses Büro wickelte neben technischen Aufgaben auch die Entschädigung der Grundstückseigentümer für die durch Fahrzeuge und Sprengungen verursachten Flurschäden ab.
Aus dem aufgelisteten Arbeitsablauf ergibt sich, dass meine Position als Vermesser ein echter Druckposten war. Wenn meine Arbeit stockte, passierte hinter mir nach kurzer Zeit nichts mehr. Dieser Fall konnte aus verschiedenen Gründen eintreten. Hierzu muss ich jedoch kurz erläutern, wie die Absteckung der Messstrecke und der Bohr- und Messpunkte erfolgte: Die Messstrecke war als Strich in einer Topografischen Karte 1:25000 eingetragen. Dort wo diese Strecke Schnittpunkte mit markanten Geländeelementen wie Straßen, Wege, Bäche, Wälder usw. bildete, markierte ich diese Schnittpunkte durch Krepppapier. Die hierzu erforderlichen Maße ermittelte ich mit einem Maßstab aus der Karte und schritt sie in der Örtlichkeit ab. Die Streckenabschnitte zwischen den markierten Punkten betrugen mehrere hundert Meter und es war ratsam, zwischendurch nach Kontrollmöglichkeiten zu suchen. Die abzusteckenden Punkte trug ich ebenfalls in die Karte ein und legte sie ebenfalls durch Schrittmaß in der Örtlichkeit fest. Der durch Schrittmaß in der Örtlichkeit ermittelte Punkt wurde mit dem in der Karte eingetragenen Punkt verglichen und ggfs. korrigiert. Für die Beibehaltung der Richtung und der Geradlinigkeit der in die Landschaft übertragenen Strecke war die Sicht auf die markierten Richtpunkte unerlässlich. Deshalb war Nebel in diesem Herbst mein größter Gegner. Er ließ sich nur in begrenztem Maße durch den Einsatz von Licht oder Kompass bezwingen. Wenn der Nebel nicht allzu dicht war, stellte ich den VW-Bulli mit eingeschalteten Scheinwerfern an einen geeigneten Punkt voraus. bei sehr dichtem Nebel musste der Kompass reichen. beide Methoden erforderten kleinräumige Kontrollen anhand der Karte. Wo geeignete Anhaltspunkte in der Karte fehlten, waren diese Methoden nicht anwendbar und der Bohrtrupp rückte näher und näher.
Weitere Hemmnisse konnten bei der Ermittlung und Benachrichtigung der Grundstückseigentümer entstehen, da ich auf die Auskunft der nächst erreichbaren Bewohner im Gebiet angewiesen war und oft erst nach langem Lamentieren der Eigentümer an die Messstrecke zurückkehren konnte – oder direkt die Arbeiten, die inzwischen bereits auf den Grundstücken begonnen hatten, stoppen musste, da die Bauern mit Mist- und Heugabeln bewaffnet eben diese Arbeiten verhindern wollten. Dieses kam glücklicherweise nur selten vor und erforderte großes Verhandlungsgeschick der Büroleute.
Die Messstrecken waren ohne Rücksicht auf die Besonderheiten der Landschaft festgelegt worden und so ging es durch eingeschneite Tannenschonungen, wo mir der Schnee in den Halsausschnitt rieselte durch Moore und über Hecken und Zäune, wodurch die Anfahrtmöglichkeiten für den Bulli oft nur sehr begrenzt möglich oder mit dem Risiko des Steckenbleibens auf schlammigen Wegen verbunden waren. Hieraus hatte sich bald eine Routine im Gebrauch des Wagenhebers und der Unterfütterung der festgefahrenen Räder mit Strauchwerk und Steinen gebildet. Dennoch brauchte all das Zeit, die meinem Messgehilfen und mir bis zum Eintreffen der Bohrmannschaften nur sehr begrenzt zur Verfügung stand. Eine besondere Situation ist mir in Erinnerung geblieben, als wir kurz vor dem Feierabend durch einen Hohlweg fuhren, der mit dichtem Herbstlaub bedeckt und beidseitig von kleinen Bäumen und Sträuchern gesäumt war. Wir hatten etwa die Hälfte dieses Weges hinter uns gelassen, als sich unser Bulli mit lautem Knall bedrohlich nach links neigte. Der Messgehilfe hatte die Situation sehr schnell erfasst, sprang laut fluchend aus dem Fahrzeug heraus und machte Anstalten, mich mit dem Problem allein zu lassen. Er lief planlos über den benachbarten Acker und weigerte sich, die unvermeidliche Verlängerung seines Arbeitstages hinzunehmen. Es war ein Choleriker, der mir bereits bei anderer Gelegenheit angedroht hatte, mich in den Kanal zu werfen, den er über die einige hundert Meter entfernte Brücke überqueren sollte, damit unsere Messstrecke fortgesetzt werden konnte.
Nach einigen Minuten hatte sich die Situation einigermaßen beruhigt und wir konnten uns an die Befreiung aus der Zwangslage machen. Der Bulli war mit den linksseitigen Rädern in einen Seitengraben abgerutscht, der durch das Laub verdeckt gewesen war und lehnte mit der oberen Kante des Aufbaus gegen den bewachsenen Wall. Eine Befreiung aus dieser Lage mit eigenen Kräften erschien aussichtslos. Zum Glück führte der Hohlweg zu einem Gehöft, das ich als nächstes aufsuchte, um den Bauern zu bitten, den Bulli mit dem Trecker frei zu schleppen. Während der Trecker den Bulli zog, musste einer von uns die Lenkung des Bullis übernehmen und ein anderer versuchen, das Dach möglichst waagerecht zu richten, damit es nicht mit den Bäumen kollidierte. Die Bergung verlief unproblematisch und der Feierabend war gerettet.
Das Verhalten meines Messgehilfen war untypisch für das Arbeitsklima des Messtrupps. Alle hatten ein Interesse daran, dass vorgegebene Arbeitspensum in der kalkulierten Zeit zu erfüllen. Die Einhaltung fester Arbeitszeiten war dabei nachrangig. Zielvorgabe für die Arbeitsplanung war, das Arbeitsvolumen innerhalb von drei Wochen zu erbringen und daran anschließend eine Woche Heimfreizeit zu erhalten. Das tägliche Arbeitspensum war dabei mit 10 Stunden inklusive Frühstücks- und Mittagspause kalkuliert. Die Samstage zählten dabei als Arbeitstage mit. Wenn das vorgesehene Arbeitsprogramm schneller erledigt werden konnte, wurde die Heimfreizeit im Verhältnis 1:1 verlängert. Diese Regelung war insbesondere für die Nutzung von Brückentagen bedeutsam. Eine Folge dieser speziellen Arbeitszeitregelung war unter anderem, dass derjenige, der zuerst mit seiner Arbeit fertig war, den nachfolgenden Arbeitsgruppen half. Das bedeutete für mich, dass ich relativ häufig mit der Kabeltrommel durch die Landschaft stapfte und etwas von dem besonderen Flair mitbekam, das der „Amigo“ – ein junger Spanier aus dem Baskenland, der die Kabelleger fuhr und organisierte – um sich verbreitete. Das besondere war der Kontrast, der zwischen seinem sanften frohen Gemüt und den überwiegend aus Emsländern, Ostfriesen und Holsteinern bestehenden Mitgliedern seiner Mannschaft bestand. Darum tat es mir gut, mich manchmal aus der Umklammerung mit meinem Messgehilfen lösen zu können.
Über das Zusammentreffen unterschiedlicher landestypischer Charaktere hinaus waren die menschlichen Faktoren, die zum Arbeitsklima beitrugen auch durch die körperlich anstrengende Arbeit und die relativ schlechten finanziellen Bedingungen mitbestimmt. Die einfachen Arbeiten zogen besonders Arbeiter aus strukturschwachen Gegenden und Männer mit schlecht belegten Auszeiten in ihrem Lebenslauf an. So kam es auch, dass ich von unserem Büroleiter den Tipp erhielt, mir von dem Messgehilfen – nicht von dem erwähnten Choleriker – ,der so gern unseren Bulli fuhr, den Führerschein zeigen zu lassen. Nach mehrmaliger Aufforderung, mir diesen vorzulegen, musste dieser – ansonsten sehr umgängliche – Kollege auf zukünftiges Autolenken verzichten.
Mit Prakla-Seismos lernte ich einige Landstriche Norddeutschlands kennen, die ich sonst kaum so intensiv wahrgenommen hätte. Zu den Voraussetzungen bzw. Umständen, die dieses ermöglichten gehörten die Unterbringung in Privatzimmern, das gemeinsame Abendessen in einem ortstypischen Restaurant und in meinem Fall auch der aufgabenbedingte Kontakt mit den Bauern der Gegend. Die Quartiere wurden durch den Büroleiter kurze Zeit vor unserem Eintreffen angemietet und in freier Abstimmung unter den Kollegen aufgeteilt. Es lag immer eine besondere Spannung in der Luft, wenn ein Umzug an einen anderen Ort anstand. Da die Orte bei einigen schon aus früheren Einsätzen bekannt waren, kursierten dann manchmal solche redensartlichen Charakterisierungen wie:“In Aurich ist es schaurig, in Leer noch viel mehr,“ (die Redensart geht noch weiter: „doch will Gott dich strafen, schickt er dich nach Wilhelmshaven!“). Meine Erinnerungen an das Aurich jener Zeit sind allerdings weniger schaurig. Während unseres Einsatzes war ich in einem zu Aurich gehörenden Dorf mit dem Namen Pfalzdorf bei einer Familie einquartiert, die mir weitgehenden Familienanschluss gewährte. Morgens erhielt ich meinen ostfriesischen Tee und ein gutes Frühstück bevor ich meinen in Aurich beheimateten Messgehilfen an einem verabredeten Treffpunkt in der Nähe seiner Wohnung abholte.
Einen Ort mit dem Namen Pfalzdorf hatte ich hier in Ostfriesland nicht erwartet und deshalb bat ich meine Vermieterin um eine Erklärung hierfür. Es handelte sich bei den Gründern dieser Siedlung um Nachfahren der Auswanderer aus der Pfalz, die um 1741 auf dem Rhein nach Rotterdam unterwegs waren, um von dort eine Schiffspassage nach Amerika zu bekommen. Viele von ihnen strandeten in Goch am Niederrhein und gründeten dort einen Ort Namens Pfalzdorf, von wo später einige der Kolonisten weiter nach Ostfriesland zogen und das dortige Pfalzdorf gründeten. Wenn auch der Tee nicht von einer Ostfriesin zubereitet worden war, so schmeckte er doch wie echter Ostfriesentee.
Eine andere Eigenart der Ostfriesen lernten wir kennen, als wir uns in der Mittagszeit in einem Landgasthaus niederließen, um etwas warmes zu trinken. Der Wirt stand hinter dem Tresen und wir waren seine einzigen Gäste. Wir wollten die ländliche Ruhe und Gelassenheit nicht stören und warteten darauf, dass der Wirt zu uns an den Tisch kam. Nach einigen Minuten hatte sich an der Position des Wirts nichts verändert und wir warteten immer noch. Nach vielleicht fünf Minuten immer noch das gleiche Bild und wir hatten eine echte Herausforderung an unsere Geduld gefunden. Schließlich gaben wir doch auf und riefen den Wirt zu uns an den Tisch. Er kam sofort ohne irgendeine Bemerkung, die zur Erklärung der Situation dienlich gewesen sein könnte und nahm unsere Bestellung kommentarlos auf. Die Mentalität der Ostfriesen wurde vor allem in den 70er und 80er Jahren in zahlreichen Witzen persifliert und brachte den Ostfriesen an sich ins Gespräch. Wenn in solchen Gesprächen auch die oben beschriebene Langmut der Wirte ins Gespräch kam, konnte ich die Richtigkeit dieser Behauptung bezeugen.
In dem halben Jahr bei den modernen Schatzsuchern lernte ich neben Rotenburg und Aurich noch Verden an der Aller und Xanten am Niederrhein näher kennen. Von diesen Städten ist mir besonders Xanten in Erinnerung geblieben – einmal wegen des dem Holländischen stark ähnelnden Dialekt, der mir die Verständigung mit den Bauern erschwerte, andererseits wegen eines Vorfalls, der mir die Möglichkeit eines unerwarteten Zuwachses von Bedeutung deutlich machte, oder wie es in der Redensart heißt: „unverhofft kommt oft„:
Unsere Messstrecke verlief in einer gut einzusehenden Landschaft mit vielen Weiden und es war ein schnelles Vorankommen möglich. Das galt auch und besonders für den Bohrtrupp, der hier mit Spültechnik schnelle Ergebnisse erzielen konnte. So bestand die Möglichkeit, dass die Löcher für die Sprengladungen schon fertig wurden, während ich noch mit der Benachrichtigung der Eigentümer beschäftigt war. Einer der benachrichtigten Bauern wurde sehr hellhörig, als ich ihm die Lage der auf seiner Weide liegenden Bohrstellen beschrieb und er äußerte den Verdacht, dass etwa dort eine geheime Pipeline der NATO verlaufe. Er erklärte sich bereit, die Situation vor Ort mit uns gemeinsam zu klären. Als wir an den fertiggestellten Bohrlöchern ankamen stellte sich heraus, dass die Sprengladungen bereits in die Bohrlöcher eingelassen waren. Unsere Hoffnung auf eine günstigere Auskunft des Bauern wurde enttäuscht und so musste eine Notlösung gefunden werden. Der hinzugerufene Sprengmeister entfernte die Zündschnüre und die Gefahr war gebannt.