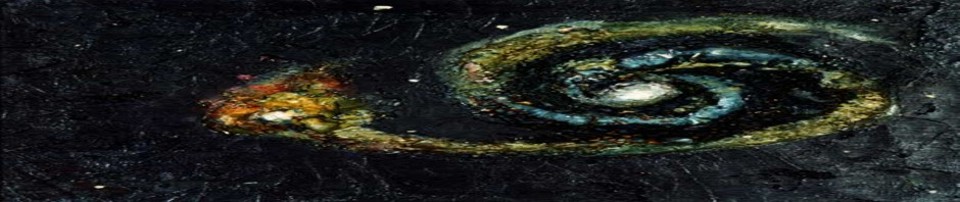Es muss etwa vor 15 Jahren gewesen sein, als ich mit Stephan, meinem Sohn, im Jahresabstand einige teils mehrtägige Wanderungen unternommen habe. Wandernd lernten wir die Eifel, die Rhön, das Sauerland, den Teutoburgerwald und die münsterländischen Baumberge kennen. Der besondere Reiz dabei sollte darin bestehen, dass wir mit Ausnahme der Route keine weitere Planung vornahmen – speziell auch auf die Buchung von Übernachtungen verzichteten. Improvisation und Spontanität sollten als sonst eher unterdrückte Bestandteile unserer Tagesabläufe erprobt werden.
Eine Wanderung ist davon besonders in Erinnerung geblieben: Wir wollten auf dem Abschnitt des Hermannsweges von Bad Iburg bis Bielefeld wandern und hatten dafür zwei Tage veranschlagt. Meine Frau brachte uns an einem Sommertag mit durchwachsenem Wetter mit dem Auto zum Startpunkt in jene Wälder, in denen Hermann der Cherusker nach dem Stand der Forschung im Jahre 9 n. Chr. den römischen Legionen aufgelauert haben soll.
An der Bundesstrasse zwischen Iburg und Georgsmarienhütte ließen wir uns absetzen, nahmen unsere Rucksäcke und hatten nur noch wenige Meter bis zur Einmündung einer ruhigen Seitenstraße zu gehen, von der wir nach etwa 150 m auf einen Weg trafen, der zu einem Haus am Waldrand führte, von wo es dann in den Wald ging. Erstes Ziel war nun, den eigentlichen Hermannsweg zu erreichen, der weitgehend auf dem Kamm des Teutoburger Waldes verläuft. Auch in diesem Punkt war ich in der Vorbereitung eher zurückhaltend gewesen, was Präzision der Routenfestlegung anging. Hier hatte ich mich auf die Wegeführungen einer topografischen Karte im Masstab 1 : 50.000 verlassen und auf die Hinzuziehung einer Wanderkarte verzichtet. Wie sich später herausstellte, führte die offizielle Wegebeschilderung den Wanderer durch den Ort Bad Iburg hindurch, so dass wir einige Kilometer nördlich des gekennzeichneten Weges starteten. Doch es stellte sich zunächst ein anderes Problem: Quer über dem Hohlweg lag ein mächtiger Baum, der uns mit seinen Ästen und Zweigen schon nach wenigen Metern den Weg versperrte. Nach kurzer Begutachtung der Situation mit dem Ziel, den besten Weg für die Überwindung des Hindernisses zu finden, stiegen wir die Böschung herauf und querten den Baum auf ihrer Krone. Beim Abstieg zurück auf den Weg passierte es dann – ich knickte mit dem rechten Fuß um. Es stellte sich schnell heraus, dass ich mit einer Verstauchung davon gekommen war. Der Schmerz war auszuhalten. Wir gingen voller Optimismus weiter und erreichten auch bald den gekennzeichneten Hauptweg.
Mittags zogen Gewitterwolken am Himmel auf und wir machten uns Gedanken, wie wir uns bei einem Gewitter verhalten sollten. Zum Glück ergab sich ein günstiges Zusammentreffen von Gewitter und Autobahnüberführung, so dass wir hier unsere Mittagspause mit dem mitgebrachten Proviant verbringen konnten.
Nach der Pause wurden die Wegverhältnisse wesentlich schwieriger. Der Gewitterregen hatte die von Schwerfahrzeugen tief eingefahrenen Spuren, die auch ohnedies schon schwierig zu begehen waren, schlammig und glitschig werden lassen. Ich musste meinem Ärger über diesen schlechten Zustand eines Fernwanderweges überregionaler Bedeutung immer wieder Luft machen, indem ich Stephan ebenfalls zu ähnlichen Kommentaren herausforderte. Doch der schien weniger Probleme mit dem Weg zu haben und schwieg.
Nach einer Weile stellten sich in meinem linken Knie Schmerzen ein, die sich kontinuierlich steigerten. Etwa auf halber Strecke unserer Tagesetappe wurde mir klar, dass wir unter diesen Bedingungen besser unsere Wanderung abbrechen sollten. Es stellte sich jedoch heraus, dass selbst der Abbruch gut überlegt sein wollte. Der Plan war nämlich, dass wir, wie ursprünglich geplant, mit dem Zug von Bielefeld zurück nach Ahlen fahren wollten. Also galt es, den Wald zu verlassen, in der Hoffnung, das ein Bahnhof in günstiger Lage zu erreichen wäre. Wie aber sollten wir das feststellen, wo wir unseren aktuellen Standort nur sehr vage einschätzen konnten und die Landschaft uns auch sonst sehr fremd war? Handys besaßen wir nicht, es war die Zeit, als Handys noch selten waren und von vielen – so auch von uns – kritisch betrachtet wurden. Darüber hinaus war auch die Funktionalität nicht mit heutigen Handys vergleichbar. Das mitgeführte Kartenmaterial half auch nicht weiter, da die Kartenausschnitte nur schmale Geländestreifen seitlich des Weges darstellten und gerade an die benachbarten Orte heranreichten. Wir standen also im wahrsten Sinn des Wortes im Wald.

Übersicht der Landschaft bei Borgholzhausen; Von User:Dst – File:Borgholzhausen Luisenturm.png, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17054387
Diese Situation war zunächst einmal zu verbessern und wir hielten Kurs auf den Waldrad in Richtung Süden, um uns einen Überblick über die Landschaft zu verschaffen. Wir hatten Glück, die Landschaft stellte sich ziemlich offen dar und wir konnten die Kirchtürme von zwei Orten sehen, doch wir waren nicht sicher, welche Orte es waren. Deshalb gingen wir auf den in Richtung unseres eigentlichen Ziels gelegenen Ort zu. Hier in dieser landwirtschaftlich intensiv genutzten Gegend waren die Wege gut zu gehen, die meisten waren asphaltiert. Hin und wieder kamen wir an einzeln stehenden Häusern vorbei, was mir wegen meinem schmerzenden Knie sehr gelegen kam, denn die Möglichkeit bei weiter zunehmenden Problemen telefonisch Hilfe zu rufen können, gab ein Gefühl von Sicherheit. Andererseits kamen wir nur langsam voran und der Abend rückte immer näher. Schließlich erkundigte Stephan sich über meinen Gesundheitszustand, halb anteilnehmend und halb vorwurfsvoll und ich antwortete ihm in der Absicht, seine Einstellung zu mir und meinem Problem eindeutig auf die anteilnehmende Seite zu verlagern: „Jeder Schritt ein Schmerzensschrei“. Die hierin zum Ausdruck gebrachte Dramatik war mir im Moment des Ausspruchs nicht bewusst gewesen, aber sie verfehlte ihre Wirkung nicht. Es war ein Thema für den weiteren Weg gefunden, das den eigentlichen Schmerz erheblich minderte, die Zeit allerdings nicht aufhalten konnte.
Spät nachmittags erreichten wir einen Landgasthof an einer Landstraße, in den wir dankbar einkehrten. Nach einer kurzen Erfrischungspause erkundigten wir uns beim Wirt, in welche Richtung wir zu dem Dorf gehen müssten, dass den Namen Borgholzhausen trug, wie wir nun erfuhren. Dabei nahm ich an, dass einem Werbespruch der Deutschen Bahn zufolge – „Wir bringen Sie ins Zentrum“, oder so ähnlich – der Bahnhof ja wohl eben dort liegen müsse. (Ich hätte mich erinnern sollen, dass ich schon einmal mit dieser Annahme hereingefallen war, nämlich in Biarritz, wo der alte Bahnhof im Stadtzentrum durch den neuen TGV-Bahnhof am Stadtrand ersetzt wurde.)
Der Straße folgend gingen wir in die vom Gastwirt angegebene Richtung zum Dorf. der Weg zog sich immer mehr und ein unbestimmtes Gefühl von Zweifel stellte sich ein. Schließlich im Dorf angekommen suchten wir auf der wie ausgestorbenen Straße nach einem ansprechbaren Menschen um uns den weiteren Weg zum Bahnhof erklären zu lassen. Endlich trafen wir jemanden – war es an einer Tankstelle oder tatsächlich ein Passant – der uns erklärte, wir müssten genau in die Richtung gehen, aus der wir gekommen waren bis wir den Ortsteil Bahnhof erreicht hätten. Diese Nachricht war einfach niederschmetternd, die leeren Straßen, die heraufziehende Dämmerung und das schmerzende Knie und jetzt nicht nur den ganzen Weg entlang der Straße zurück sondern dazu etwa noch einmal soweit von der Gaststätte zum Bahnhof – denke ich an diese Situation zurück, fällt mir der Spruch aus Dantes göttlicher Komödie ein:“Lasst, die Ihr eintretet, alle Hoffnung fahren!“
Was nun folgte, lässt sich nur als ein „Schleppen“ meines Körpers entlang der Landstraße bezeichnen. Nichts anderes als meinen Körper konnte ich noch wahrnehmen. Auch Stephan wagte es nicht mehr, mich an die Dramatik des Schmerzensschreis zu erinnern. Dramatik war nun der Resignation auf dem Boden eines bösen Schicksal gewichen.
Als wir im Ortsteil Bahnhof ankamen war es bereits dunkel und wir wussten, dass wir auf schnellstem Wege zum Bahnhof gelangen mussten, da der „Haller Willem“ nur eine sehr begrenzte Taktungfrequenz erwarten ließ – was für diese eingleisige Nebenstrecke als normal gelten konnte und am Samstagabend erst recht. Wir brauchten nicht lange suchen, an der Kreuzung der Straße auf der wir gekommen waren mit den Bahngeleisen befand sich auch der Bahnhaltepunkt, Bahnhof wäre zuviel gesagt für einen Fahrkartenautomaten neben einem Anschlagkasten, in dem der Fahrplan hing und einer überdachten Sitzbank. Dieses Ambiente verstärkte meine Befürchtungen bezüglich der Taktfrequenz und ein kurzer Blick auf den Fahrplan ließ sie zur Wirklichkeit werden, der letzte Zug war vor etwa einer Stunde abgefahren. Was sich nun in meinem Gefühlshaushalt abspielte überraschte mich. Statt noch tiefere Verzweiflung stellte sich ein Gefühl der Erleichterung ein, was vielleicht darauf zurückzuführen war, dass wir uns über die Fortsetzung der Bahnfahrt in Bielefeld nun keine Gedanken mehr machen mussten und es hatte sich ein Verlangen nach Geborgenheit eingestellt, die in einer Fastfood-Mahlzeit im Schnellimbiss bestehen mochte. Diese Möglichkeit war realistisch, da wir an einem kleinen Imbiss vorbeigekommen waren, den wir nun aufsuchten um unsere Laune durch etwas Warmes im Bauch zu heben und unsere neue Situation zu durchdenken.
In dem Imbiss war nicht viel Betrieb und wir konnten uns der Aufmerksamkeit des Betreibers sicher sein. Die Auswahl nach der Karte war schnell getroffen und der Betreiber war so nett, uns sein schnurloses Telefon zur Verfügung zu stellen, nachdem ich ihm unsere Situation geschildert hatte. Unser Notfallplan sah nun so aus, dass wir versuchen wollten, meine Frau anzurufen und sie zu bitten, uns abzuholen. Ich wusste, sie würde bei einer Freundin in der Nachbarschaft deren Geburtstag feiern. Dort rief ich sie an und erlebte die nächste Enttäuschung. Sie hatte bereits einige Gläser Bowle getrunken und wollte kein Risiko mit dem Auto eingehen. Das war ein überzeugendes Argument und nun musste Plan B greifen. Dieser war so schnöde wie der Mammon und basierte im wesentlichen auf der Hoffnung, von Bielefeld aus mit der Bahn nach Ahlen fahren zu können, oder doch dort wenigstens im Hotel übernachten zu können.
Wir ließen uns mit einem Taxi nach Bielefeld bringen und stellten dort fest, dass es um 0:10 Uhr eine Zugverbindung mit einem Nahverkehrszug Richtung Ruhrgebiet geben würde. Bis dahin hatten wir noch etwa eine Stunde Zeit. Kurz vor der Abfahrtzeit fanden wir uns wieder auf dem Bahnsteig ein. Es wurde 0:10 und es war noch keine Ankündigung des Zuges über den Lautsprecher gekommen. Minuten über Minuten verstrichen und es passierte nichts. Weder waren auf den Bahnsteigen Menschen zu sehen, noch war etwas über den Lautsprecher zu hören. Schließlich studierte ich akribisch den Fahrplan und stellte fest, dass mich die Hoffnung auf ein glückliches Ende unserer Odyssee überwältigt hatte. In dem Fahrplan war die Abfahrtzeit mit einem kleinen Hinweis versehen, der bedeutete, dass dieser Zug sonntags nicht verkehrt. Es war zwar noch Samstag gewesen, als ich kurz nach Ankunft in Bielefeld auf den Fahrplan geschaut hatte, doch die Abfahrtzeitpunkt war Sonntag. Nun waren unsere Reisemöglichkeiten also endgültig erschöpft, außer wir würden uns mit dem Taxi nach Hause bringen lassen. Soweit ging die Sehnsucht nach dem eigenen Bett dann doch nicht. Schließlich hatte ich ja schon einmal eine unfreiwillige Nacht im Bahnhof von Köln verbracht, ohne dass es zu großer psychischer Belastung geworden wäre. Immerhin hatte es dort die Fahrgäste mehrerer Züge getroffen, die nun auf den Bahnsteigen und im Bahnhofsgebäude umherschlenderten. Einen Teil der Zeit verbrachte ich damals im Gespräch mit einem chinesischen Gastprofessor der TH Aachen aus Taiwan, der das deutsche Eisenbahnwesen studierte. Er konnte es nicht begreifen, dass die Deutsche Bahn die Situation so schlecht managte. So war die Zeit im Gespräch und in der Beobachtung der Menschen schnell vergangen. Diese Erfahrung hatte mich auch gelehrt, dass zu später Stunde – selbst im Bahnhofshotel – kein Zimmer mehr zu bekommen ist.
Der Entschluss stand fest, diese Nacht würden wir auf dem Bielefelder Bahnhof verbringen. Nur gab es hier nicht viel Ablenkung von unserem Schlafbedürfnis und so suchten wir schon bald nach geeigneten Plätzen für ein wenig Schlaf. Wie machten es die Obdachlosen, die hier ebenfalls einen Schlafplatz suchten? Sie lagen auf ihren Jacken auf dem Steinboden eines verglasten Warteraums auf dem Bahnsteig, wo wir uns, nach dem vergeblichen Versuch, auf der aus aneinandergereihten Schalensitzen zusammengesetzten Bank zu liegen, ebenfalls bis zum Morgen ausstreckten.
Mit dem ersten Zug fuhren wir nach Ahlen, wo wir von unserer Odyssee zu berichten hatten. Was die Erinnerung an diese Erlebnisse immer wieder wachruft, ist mein Klagelied „jeder Schritt ein Schmerzensschrei“, das sich als Thema unserer gesamten Odyssee herausstellte.